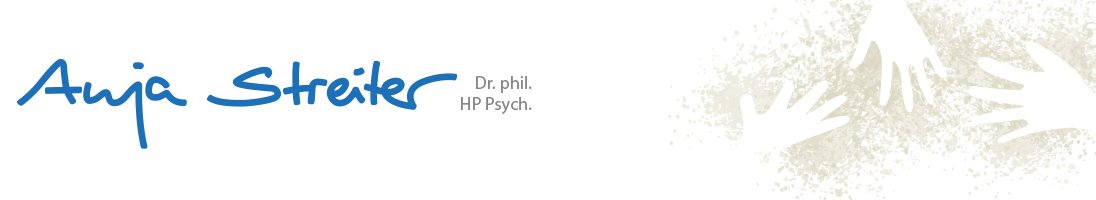Somatics: Wie ein Forschungsfeld entsteht und sich reflektiert
Was meint Somatics?
Somatics ist ein relativ neuer Begriff für eine Vielzahl von pädagogischen oder therapeutischen Methoden und Techniken, in denen körperzentriert mit der Schulung des Körperbewußtseins, mit Berührung und Bewegung gearbeitet wird und deren gemeinsame Basis Erkenntnisse über das Ineinandergreifen von psychischen und physischen Prozessen ist.
Der amerikanische Feldenkrais-Lehrer und Begründer einer eigenen Methode, Thomas Hanna, prägte das die Methodenvielfalt überspannende Konzept Somatics Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in verschiedenen Veröffentlichungen und stärkte es durch die Herausgabe der gleichnamigen Zeitschrift Somatics. Hier erschienen seit den 70er Jahren Artikel u.a. über Biofeedback, Phänomenologie, Kampfkünste, Meditation, Tanz, Pädagogik, Yoga, Sensory Awareness, Akupunktur, Autogenes Training und ethische Fragen sowie Artikel über „Pioniere“ wie Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Carl Rogers, Gerda Alexander, Carola Speads und F. Matthias Alexander. (vgl. http://www.somaticsed.com)
Hanna definierte in seinen Schriften Somatics als das
„Feld, in dem das Soma erforscht wird, d.h. der von innen, durch Selbstwahrnehmung wahrgenommene Körper.“ (T. Hanna: What Is Somatics? (1986), in: Don Hanlon Johnson (Hg.), Bone, Breath & Gesture. Practices of Embodiment, 1995)
Wie viele seiner Kolleg_innen forschte und praktizierte Thomas Hanna mit dem Ziel zu verstehen, wie der lebendige Körper sich selbst reguliert und wie Menschen durch gezielte Aufmerksamkeitsschulung ungünstige und bis dahin unbewusste Muster der Bewegung und des Verhaltens wahrnehmen und verändern können. Das nannte er „somatisches Lernen.“
Ein Generatives Konzept – Gründung eines Feldes
Somatics waren in den 70 er Jahren alles andere als ein etabliertes Forschungs- und Praxisfeld, mit Praktizierenden und Forschenden, die einander als Kolleg_innen respektierten, mit Berufsverbänden, Kongressen, Studiengängen, mit Fördermitteln für die Forschung und institutioneller Anerkennung. Dieses Feld hatte gerade begonnen, sich zu konstituieren.
In den frühen 60er Jahren hatten sich verschiedene Therapeut_innen der humanistischen Psychologie in den USA im Human Potential Movement zusammengeschlossen. Sie gingen von einem zumeist ungenutzten menschlichen Potential für ein glückliches, kreatives und selbstbestimmtes Leben aus und suchten nach Wegen, dieses Potential zu entfalten. Treffpunkt dieser Psycholog_innen, die bald eine ganze Reihe von Bewegungspädagog_innen und Körpertherapeut_innen zum Austausch einluden, war das zu diesem Zweck gegründete Esalen Institut (http://www.esalen.org) an der nordkalifornischen Küste.
Dieses idyllisch gelegene Institut wurde schnell und blieb über Jahrzehnte eines der bedeutendsten Zentren für das Forschungsfeld Somatics. Hier diskutierte die Begründer_innen verschiedener körpertherapeutischer und psychotherapeutischer Methoden miteinander, zeigten sich ihre Techniken und wandten sie aneinander an. Hier begannen sie auch, die Vorgeschichte ihrer eigenen Geschichte zu verstehen, ihre Arbeit in Bezug auf soziale Visionen zu denken und sich der spirituellen Dimension zu öffnen. (Vgl. http://donhanlonjohnson.com)
Die Geschichte der Somatics, als Konstituierung eines US amerikanischen Forschungsfeldes mit einem Forschungsgegenstand, mit Forschungsmethoden und Fragestellungen beginnt im Esalen Institut. Aber die Forschungen selbst ziehen die Entstehungslinien viel weiter zurück und weit über die USA hinaus in andere Kontinente, andere Kulturen, andere Jahrhunderte und andere Bereiche als die der Psychologie, Bewegungs-Pädagogik und Massage.
Hanna trug mit seiner vorgeschlagenen Begrifflichkeit sehr dazu bei, dass in den USA eine Vielzahl von Vertreter_innen verschiedener Methoden und Praktiken von Körperarbeit, Körpertherapie, Bewegungspädagogik und Psychotherapie begannen, sich als zu einer Gemeinschaft gehörig zu betrachteten und miteinander über den möglichen gemeinsamen Forschungs- und Praxisbereich zu diskutieren.
„Somatics ist ein generatives Konzept wie „Kognitionswissenschaften“ oder „Ökologie“ oder „Qi Gong“; Namen, deren Aufgabe es ist, für Gemeinschaften, die ansonsten isoliert von einander und oft in Konkurrenz und Konflikt sind, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu schaffen. So schienen einst zwischen Reichianischer Bioenergetik, Rolfing und Hatha Yoga Welten zu liegen. Jetzt, dank dieses neuen Paradigmas, können wir sehen, wie jede dieser Praktiken die anderen verstärken und effektiver machen kann.“ (http://www.donhanlonjohnson.com/somatics.html)
Qi Gong z.B. ist ein Begriff, der erst im 20. Jahrhundert als Oberbegriff für hunderte von verschiedenen Übe-Systemen geprägt wurde, mit der Absicht, ihren Zusammenhang, ihre gemeinsamen Prinzipien und ihre Herkunft aus einer chinesischen Tradition hervorzuheben. Es ging darum, die chinesische Medizin, zu der diese Übe-Systeme teilweise gehörten, gegenüber dem Einfluss der westlichen Medizin zu stärken. Auch Somatics ist ein Begriff, der nach innen für mehr Dialog und Einigkeit sorgen sollte, damit dann auch nach außen das gemeinsame Anliegen besser vertreten werden konnte.
Ein Pendant zu der Bewegung der Selbstreflexion und Selbstorganisation der Somatics in den USA ist in den 80er Jahren die Gründung eines europäischen Dachverbandes der körperpsychotherapeutischen Methoden: European Association for Bodypsychotherapie (http://eabp.org). Dieser Verband grenzt sich allerdings gegen körpertherapeutische Methoden ab, die nach Einschätzung der Verbandsmitglieder kein genügend ausformuliertes zugrundeliegendes psychotherapeutisches Konzept haben. (Dahinter steht der nicht bewiesene Vorwurf, dass bei Praktiken, Techniken oder Methoden, denen eine integrierende psychologische Theorie fehlt, es auch an Integrationsmöglichkeiten des Erlebten für die Klienten fehlen könnte.)
Diese Abgrenzung gibt es im Begriff Somatics nicht.
Ideale Körper? – Die politische Dimension
Im Prozess der Verständigung über gemeinsame Anliegen, Grundlagen und Prinzipien, im Austausch über die jeweiligen Arbeitsweisen und in der Entwicklung von Ausbildungsrichtlinien in den USA, wuchs auch dort das Bewusstsein der Differenzen. Eine wichtige Frage war: Gibt es ein universelles, allen Methoden zugrundeliegendes Idealbild des Menschen? Konkret: Gibt es die „richtige“ Beckenstellung mit der „richtigen“ Schwingung der Wirbelsäule für alle? War es richtig, Klient_innen manipulativ in die „richtigen“ Ausrichtungen zu bringen, wie es Anfangs z.B. Ida Rolf praktizierte? Oder galt es, jeder und jedem Wege zu zeigen, die Bedürfnisse des eigenen, trotz aller Gemeinsamkeit mit allen anderen menschlichen Körpern einzigartig verfassten Körpers zu spüren, dessen Impulse wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben? War das Ziel die Annäherung an ein Ideal, oder ging es um die Unterstützung auf dem Weg, die je eigene, einzigartige Weise, in der Welt zu stehen und handeln, entfalten zu lernen?
Diesen Teil der Geschichte und Selbstreflexion der Somatics hat Don Hanlon Johnson, einstiger Jesuit und Doktor der Philosophie, dann zertifizierter Rolfer und 1983 Begründer des ersten akademischen Studiengangs für Somatics, in seinen Büchern in der ganzen philosophischen, spirituellen und politischen Dimension verstehbar gemacht. (http://www.donhanlonjohnson.com/publishing.html)
Don Hanlon Johnson litt seit seiner frühesten Kindheit unter einer komplett versteiften Wirbelsäule. Sein Körper widerstand allen Manipulationen in Richtung der idealen Ausrichtung. Ida Rolf, seine Ausbilderin, gab ihm zu verstehen, dass mit seinem Körper eine wirklich tiefe, spirituelle Entfaltung nie möglich sei. In den folgenden Jahren löste sich Johnson allmählich von den Schulen des Idealbildes und des Idealkörpers in Religion und in Somatics. Seine Erfahrungen und Forschungen führten ihn zu der zutiefst demokratischen Auffassung, dass jeder Mensch kraft seines einzigartigen Standpunktes auf seinen einzigartig geformten Füßen eine unvertretbare, weder ersetz- noch verallgemeinerbare Sicht auf die Welt hat. Und jeder Mensch bedarf der Kenntnis möglichst vieler anderer verkörperter Standpunkte, um sich ein möglichst vieldimensionales Bild von der Welt zu machen. Auch körpertherapeutische Methoden können, so Don Hanlon Johnson, entweder demokratisch wirken, indem sie die Einzigartigkeit eines Jeden wertschätzen oder Züge einer organisierten Religion oder einer anderen totalitären Institution tragen, indem sie das Leben und den Körper der Einzelnen irgendeiner Norm, einem Ideal oder einem Kollektiv unterordnen.
Die politische und soziale Dimension der Ermöglichung oder Einschränkung körperlicher Selbstwahrnehmung, Selbstannahme, Selbstregulation und Selbstwirksamkeit wird in den historischen Forschungen über die zumeist europäischen Vorgeschichte der amerikanischen Somatics sehr deutlich. Die historischen Linien führen zunächst nach Nordeuropa Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach Deutschland in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.
Karoline von Steinacker hat in ihrem Buch: Luftsprünge. Anfänge moderner Körpertherapien (München 2000) die vielfältigen Gruppierungen und Ziele der Atem-und Leibpädagogik, der Nacktkultur, der frühen Umweltbewegung und der Jugendbewegung im deutschsprachigen Raum der 1920er Jahre untersucht. Diese Bewegungen waren auf der Suchen nach einem von industrieller Fron und Dunkelheit befreiten ‚natürlichen’ Körper und es waren nur feine Unterschiede, welche die faschistischen von den demokratischen Richtungen trennten. Beide hatten gemeinsame Schönheits-, Reinheits- und Ordnungs-Ideale. Griechische Statuen nackter Menschen waren in Tanz, Gymnastik und Film Vorbilder für den ausbalancierten, mühelos kraftvollen, zentrierten Menschen. Elsa Gindler, eine der Gründerfiguren der deutschen Leib-und Atempädagogik, arbeitete mit diesem Ideal genauso wie Leni Riefenstahl, die es in ihren Filmen in Szene setzte. Die Trennlinie aber war der scheinbar kleine Unterschied zwischen der spielerischen Bewegung „mit gelöster Muskulatur“ in der Leibpädagogik Gindler und der strammen, „überspannten Haltung“ in den nationalsozialistischen Filmen Riefenstahls. (Vgl. hierzu Karoline von Steinacker, a.a.O.)
Eine Geschichte, die noch nicht geschrieben ist
In dem besonders explosiven Kontext der deutschen Zwischenkriegszeit wird die historische und gesellschaftliche Prägung und Wirkung von Körperbildern und -methoden besonders greifbar. Die Arbeit an einer befreiten, aufrechten, „natürlichen“ Haltung und die Vorlieben und Vorbilder im Ausdruck entwickelten sich in einem dichten Netz gesellschaftspolitischer, künstlerischer und spiritueller Bewegungen. Sie sind von den Entwicklungen im Tanz und Schauspiel genauso wenig zu trennen wie von ökonomischen oder medizinischen Entwicklungen, pädagogischen Lehren oder der Entwicklung des Geschlechterverhältnisses.
So spielten z.B. Frauen in der Entwicklung von Methoden der Schulung des Körperbewusstseins und der Selbstregulationsfähigkeiten in der europäischen Zwischenkriegszeit und danach eine entscheidende Rolle. Daher steht die Geschichtsschreibung dieser Methoden vor ähnlichen Problemen wie die Geschichtsschreibung der weiblichen Seite der Menschheitsgeschichte überhaupt: das Meiste ist nur mündlich überliefert. Dasselbe gilt auch hinsichtlich der außereuropäischen Wurzeln der Somatics. (Vgl. Martha Eddy, Begründerin des Center for Kinesthetic Education (CKE), in ihrem Artikel: Somatic Practices and Dance: Global Influences, 2002, http://wellnesscke.net/articles/globalinfluences.pdf)
Weil niemand genau weiß, was in den verschiedenen Klassen der verschiedenen Lehrerinnen geschah und welche Lehrer-innen welche Schüler_innen wie stark geprägt haben, ist eine Genealogie dieser Methoden, der Stammbaum der Somatics, nicht ganz einfach zu schreiben. Ein solcher Stammbaum müsste die transnationale und interdisziplinäre Geschichte der Berührungspunkte zwischen u.a. europäischer und US-amerikanischer Bewegungspädagogik, Tanz-, Gesangs- und Schauspielpädagogik, psychoanalytischen und körpertherapeutischen Schulen abbilden und den Blick über diesen Raum hinaus erweitern auf die Einflüsse amerikanischer, afrikanischer, indischer und asiatischer Kulturen, ihrer Traditionen und Methoden der Bewegung, ihrer pädagogischen, medizinischen und kulturellen Praktiken, ihrer gesellschaftlichen Systeme und ihrer Spiritualität.
© 2016 Anja Streiter
(Eine frühere Fassung dieses Textes findet sich auf der Homepage der Somatischen Akademie Berlin. Auch hier gilt das Urheberrecht.)